innesang.com: Buchkritik
innesang.com: Buchkritik |
Minnesang.com Dr. Lothar Jahn Guderoder Weg 6 34369 Hofgeismar 05671-925355 E-mail an Minnesang.com NOTENBÜCHER 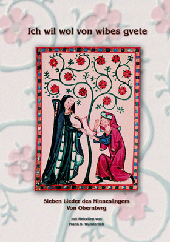 Frank Wunderlichs schöne Vertonungen der Minnelieder des Sängers "von Obernburg". Mit Nachdichtungen von Dr. Lothar Jahn. Bestellen bei www.minnesang.com für 8 Euro plus 3 Euro Versand! Frank Wunderlichs Neuvertonungen der Werke der "Minnesängerin Gottes". Inklusive "Dy Minne" in der Vertonung von Ougenweide. Bestellen beim Verlag der Spielleute. 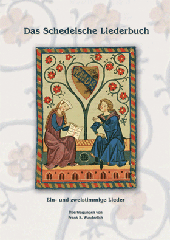 Das Schedelsche Liederbuch in einer Neubearbeitung von Frank Wunderlich. Bestellen beim Verlag der Spielleute. 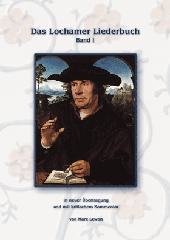 Das Lochamer Liederbuch in einer Neubearbeitung von Marc Lewon. 3 Bände erhältlich. Bestellen beim Verlag der Spielleute. 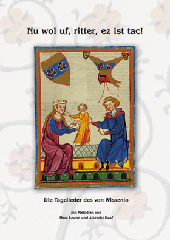 Neuvertonungen der Lieder des Minnesängers "von Wissenloh", von Marc Lewon und Albrecht Haaf.. Bestellen beim Verlag der Spielleute. 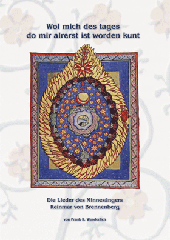 Die Originamlmusik der Minnelieder des Reinmar von Brennenberg, dazu einige Neuvertonungen von Frank Wunderlich. Bestellen beim Verlag der Spielleute. >> NOTEN VON MINNELIEDERN BESTELLEN BEI MINNESANG.COM. |
Jule Bauer: Nyckelharpa – Playing the Nyckelharpa/Nyckelharpa spielen > Verlag der Spielleute, 118 Seiten, EUR 24,90 Hans Moser: Wie eine Feder leicht, Oswald von Wolkenstein - Lieder und Nachdichtungen > Laurin-Verlag, Innsbruck, EUR 19,90 Katharina Zeppezauer-Wachauer: Kurzwîl als Entertainment, Das Mittelalterfest als populärkulturelle Mittelalterrezeption. Historisch-ethnografische Betrachtungen zum Event als Spiel  Frau
Zeppezauer-Wachauer geht der Frage nach, was das Mittelalterfest seit
mehr als zwei Jahrzehnten so attraktiv macht. Eine berechtigte Frage,
denn immer noch boomt die Veranstaltungswelle, und klagen die Puristen
auch über die Mittelalter-Bratwurst, die gegen Silberlinge in
jedem Kuhkaff dem Fremdling vom gewandeten Rittersmann gereicht wird,
so vermag das Drängen auf Authentizität gar nichts gegen die
Attraktivität solcher "Events" auszurichten. Die Autorin geht das
Phänomen mit wissenschaftlicher Akribie im Geiste der Spieltheorie
nach Huiziga und Caillios an: Sie sieht die Events als Fest und Spiel
gleichermaßen, bei dem die Akteure bewusst aus dem Alltag
heraustreten. Die spieltheoretischen Begriffe "agôn" (Kampf und
Wettbewerb), "alea" (Glücksspiele), "mimicry" (Verkleidung) und
"ilinx" (Rauschspiele) findet sie allesamt in den Ritualen der
Mittelaltermärkte und -feste wieder. Die ersten drei Kategorien
erschließen sich bei Ritterturnieren, Mäuseroulette und
Gewandungslust dem Leser sofort, das rauschhafte Element ortet sie beim
Met-Trinken im Badezuber, es kommt aber insgesamt vielleicht ein wenig
zu kurz. Hier hätte auch die Musik, die ja eine tragende Rolle im
MA-Entertainment hat, stärker untersucht werden können,
erstaunlicherweise beschäftigt sie sich damit fast gar nicht.
Trotzdem wird deutlich, dass die in der Szene verbreitete Furcht (oder
bei manchem auch Hoffnung), die Mittelalterwelle würde irgendwann
abebben, wohl unbegründet ist: Zu attraktiv ist diese irgendwo
zwischen Karneval und Volksfest angesiedelte Form, sich
spielerisch in eine andere Zeit und Welt zu begeben. Ihre
allgemein gehaltenen Thesen überprüft die Autorin durch die
Analyse der "Spielmodelle" bei Mittelalterfesten auf der Festung
Hohensalzburg, in Mauterndorf, Burghausen und Eggenburg. (lj) Frau
Zeppezauer-Wachauer geht der Frage nach, was das Mittelalterfest seit
mehr als zwei Jahrzehnten so attraktiv macht. Eine berechtigte Frage,
denn immer noch boomt die Veranstaltungswelle, und klagen die Puristen
auch über die Mittelalter-Bratwurst, die gegen Silberlinge in
jedem Kuhkaff dem Fremdling vom gewandeten Rittersmann gereicht wird,
so vermag das Drängen auf Authentizität gar nichts gegen die
Attraktivität solcher "Events" auszurichten. Die Autorin geht das
Phänomen mit wissenschaftlicher Akribie im Geiste der Spieltheorie
nach Huiziga und Caillios an: Sie sieht die Events als Fest und Spiel
gleichermaßen, bei dem die Akteure bewusst aus dem Alltag
heraustreten. Die spieltheoretischen Begriffe "agôn" (Kampf und
Wettbewerb), "alea" (Glücksspiele), "mimicry" (Verkleidung) und
"ilinx" (Rauschspiele) findet sie allesamt in den Ritualen der
Mittelaltermärkte und -feste wieder. Die ersten drei Kategorien
erschließen sich bei Ritterturnieren, Mäuseroulette und
Gewandungslust dem Leser sofort, das rauschhafte Element ortet sie beim
Met-Trinken im Badezuber, es kommt aber insgesamt vielleicht ein wenig
zu kurz. Hier hätte auch die Musik, die ja eine tragende Rolle im
MA-Entertainment hat, stärker untersucht werden können,
erstaunlicherweise beschäftigt sie sich damit fast gar nicht.
Trotzdem wird deutlich, dass die in der Szene verbreitete Furcht (oder
bei manchem auch Hoffnung), die Mittelalterwelle würde irgendwann
abebben, wohl unbegründet ist: Zu attraktiv ist diese irgendwo
zwischen Karneval und Volksfest angesiedelte Form, sich
spielerisch in eine andere Zeit und Welt zu begeben. Ihre
allgemein gehaltenen Thesen überprüft die Autorin durch die
Analyse der "Spielmodelle" bei Mittelalterfesten auf der Festung
Hohensalzburg, in Mauterndorf, Burghausen und Eggenburg. (lj)> Tectum-Verlag Marburg, 167 S., EUR 24,90 Volker Gallé (Hg.): Dichtung und Musik der Stauferzeit  Worms,
in der Stauferzeit eins der Zentren höfischer Repräsentation
und Kultur, widmet sich dankenswerterweise schon seit längerem
diesem Erbe. Mit einem wissenschaftlichen Symposion im Stauferjahr 2010
zum Thema „Dichtung und Musik der Stauferzeit“ wurde diese
gute Tradition fortgesetzt. Nun liegt im Worms-Verlag eine
Dokumentation der Veranstaltung vor. Worms,
in der Stauferzeit eins der Zentren höfischer Repräsentation
und Kultur, widmet sich dankenswerterweise schon seit längerem
diesem Erbe. Mit einem wissenschaftlichen Symposion im Stauferjahr 2010
zum Thema „Dichtung und Musik der Stauferzeit“ wurde diese
gute Tradition fortgesetzt. Nun liegt im Worms-Verlag eine
Dokumentation der Veranstaltung vor.War die Babarossa-Gattin Beatrix von Burgund die „Traumfrau der Minnesänger“, fragt Ellen Bender unter Bezug auf diese Behauptung in Umberto Ecos Schelmenroman Baudolino. Aber gegen Baudolino und seine ausufernde Fantasie war Käpt'n Blaubär ein Waisenknabe, und Ellen Bender kann nur Vermutungen beisteuern. Vor allem an dem Minnelied „Si ist ze allen êren ein wîp wol erkant“ macht sie eine direkte Beatrix-Preisung fest. Dafür spräche aber nur das Ende der vierten Strophe, in dem Morungen ihren Ruhm über alle anderen deutschen Frauen stellt. Dass er ihren leuchtend roten Mund und ihre strahlend weißen Zähne preist, scheint als Beweis dann doch sehr weit hergeholt, wenn auch Beatrix' Zahnpflege beim Chronisten Acerbus Morena hervorgehoben wird. Stichhaltiger wirken schon die Überlegungen von Gert Hübner über die Beziehungen zwischen rheinischem und romanischen Minnesang. Er analysiert an Beispielen, wie die in Rheinnähe heimischen Sänger französische Vorbilder aufgreifen, aber auch den“gelegentlich am Rehin llokalisierten Frauendienst anhand seiner Relationen zum Gottesdienst auf dem Kreuzzug und zum Herrendienst auf dem Italienzug“ verhandeln. Er sieht im Minnesang keine zweite Gruppe von Dichtern, die derartig in einem Sinnkomplex miteinander vernetzt wirkt. Mit Spannung liest man natürlich Marc Lewons Beitrag „Wie klang Minnesang?“ Er stellt sich vor allem dem Klischee des Minnesängers mit der Laute vor dem Fenster der Liebsten entgegen. Wichtig ist ihm, dass der Minnesang höfische Repräsentationskunst ist, die sich trotz Einstimmigkeit (die nicht Eintönigkeit bedeutet, sondern Raffinesse in der Ausführung erfordert) künstlerisch auf höchstem Niveau bewegt haben muss. Trotz aller tiefen Empfindung in Text und Musik ist also nicht die subjektive Liebesbekundung das Eigentliche, sondern die Preisung der Dame und dadurch auch des Herren! Er nimmt dem Sänger aber nicht nur die Liebste und das Fenster, sondern auch die Laute weg. Aufgrund der ihm bekannten Literatur und Bilddarstellung schließt er die Abkömmlinge von „al-ʿūd“ nebst aller Verwandten wie Citole, Quinterne, Cetula und wie sie alle heißen, schlichtweg als Begleitinstrumente aus. Das tut einem, der den Sang zum Klang der geschlagenen und gezupften Saiten kennen und lieben lernte, erstmal richtig weh. Statt dessen rückt er die Fidel (Vielle) nebst Rebec in den Mittelpunkt, dazu spielen Psalter und Harfe, aber auch Leier, Traversflöte und Drehleier auf. Lewon geht von solistischen Auftritten als dem Regelfall aus, allenfalls begleitet durch kleine Instrumental-Ensembles. Hörenswert ist sein Plädoyer, die Sangspruchüberlieferung, die vor allem durch die Jenaer Liederhandschrift musikalisch ja weit umfangreicher ist als der Minnesang, stärker in der Aufführungspraxis zu berücksichtigen. Diese Überbetonung des Minnesangs sieht er als ein weiteres Erbe der Romantik an, die fälschlicherweise ihr Liebesideal in den Hohen Sang hineininterpretierte. Weitere Beiträge setzen sich mit der sizilianischen Dichterschule auseinander, mit islamischen Instrumenten an europäischen Höfen und mit Zeugnissen des Herrschaftsanspruches der Staufer in Worms. Schließlich setzt sich Elke Ukena-Best mit den trotz ihrer hohen Herkunft wenig beachteten Lyrik der beiden Sänger auseinander, die die Manessische Handschrift eröffnen: Die Staufer Kaiser Heinrich IV. und König Konrad, der Junge. Alles in allem ein lesenswerter Band! (lj) > Worms-Verlag, 214 S., EUR 19,90 Robert Löhr: Krieg der Sänger. Roman 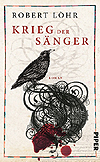 Robert
Löhr bewegt sich ja schon einige Zeit mit
Einfühlungsvermögen, Detailkenntnis und feiner Ironie auf den
Spuren literarischer Glanzlichter vergangener Zeiten. Nach dem
„Erlkönig-Manöver“ und dem
„Hamlet-Komplott“ geht es nun noch weiter zurück in
die Vergangenheit. In dem Roman „Krieg der Sänger“,
der im Frühjahr 2012 bei Piper erschien, führt er seine Leser
in die Welt des Sängerkriegs auf der Wartburg ein. Die Legende,
auf der der Roman fußt, findet sich in vielen mittelalterlichen
Handschriften, und diente in der Romantik Dichtern wie Novalis
(„Heinrich von Ofterdingen“), E.T.A. Hoffmann („Der
Kampf der Sänger“) und Friedrich de la Motte Fouqué
(Dichterspiel „Der Sängerkrieg auf der Wartburg“) als
Anregung für eigene Werke. Die bekannteste Verarbeitung ist
natürlich Richard Wagners Oper „Tannhäuser oder Der
Sängerkrieg auf der Wartburg“, die den Stoff mit der
Tanhuser- und Elisabeth-Legende verquirlte zu einer weiteren Variation
Wagnerscher Helden- und Liebestod-Erlösungsmystik. Robert
Löhr bewegt sich ja schon einige Zeit mit
Einfühlungsvermögen, Detailkenntnis und feiner Ironie auf den
Spuren literarischer Glanzlichter vergangener Zeiten. Nach dem
„Erlkönig-Manöver“ und dem
„Hamlet-Komplott“ geht es nun noch weiter zurück in
die Vergangenheit. In dem Roman „Krieg der Sänger“,
der im Frühjahr 2012 bei Piper erschien, führt er seine Leser
in die Welt des Sängerkriegs auf der Wartburg ein. Die Legende,
auf der der Roman fußt, findet sich in vielen mittelalterlichen
Handschriften, und diente in der Romantik Dichtern wie Novalis
(„Heinrich von Ofterdingen“), E.T.A. Hoffmann („Der
Kampf der Sänger“) und Friedrich de la Motte Fouqué
(Dichterspiel „Der Sängerkrieg auf der Wartburg“) als
Anregung für eigene Werke. Die bekannteste Verarbeitung ist
natürlich Richard Wagners Oper „Tannhäuser oder Der
Sängerkrieg auf der Wartburg“, die den Stoff mit der
Tanhuser- und Elisabeth-Legende verquirlte zu einer weiteren Variation
Wagnerscher Helden- und Liebestod-Erlösungsmystik. Doch von solchem Pathos ist Löhrs Werk weit entfernt. Es spinnt aus den bekannten zeitgeschichtlichen Tatsachen um Landgraf Hermanns Hofkreis, den Thronstreit zwischen Staufern und Welfen, die Kreuzzüge sowie den Lebensgeschichten und Dichtungen der beteiligten Sänger eine durchaus plausible Handlung, die als Grundlage zur um 1250 entstandenen Legende hätte dienen können. Er schreibt in einem eleganten geschliffenen Stil, der ebenso wie die akribische Recherche im erfreulichen Gegensatz zum Standard dessen steht, was uns heute als „historischer Roman“ kiloweise auf den Büchertisch gelegt wird. Seine Kontrahenten sind glaubwürdige, lebensnahe Persönlichkeiten und trotzdem bleibt genug Raum für augenzwinkernde Anspielungen, an denen Professoren, Hobby-Historiker und Interpreten des Minnesangs ihre helle Freude haben werden. Der selbstbewusste und erfolgsverwohnte Walther von der Vogelweide, der ritterlich geläuterte Ependichter Wolfram von Eschenbach, der den Künsten zugewandte, aber auch politisch und menschlich unzuverlässige Landgraf Hermann sowie sein grobschlächtiger Günstling Gerhard Atze – sie begegnen uns so, wie wir sie vor dem geistigen Auge hatten. Auch „Reinmar, der Alte“, Vordenker und Wegbereiter der schmerzensreichen hohen Minne, wird würdig in Szene gesetzt. Dass Löhr dem Greis das Augenlicht genommen hat, macht ihn nur noch eindrucksvoller. Überraschungen gibt es beim weiteren Personal, zu dem uns nur spärliche Fakten bekannt sind: Am meisten weiß man noch vom „Tugendhaften Schreiber“, der ein korrekter Dienstmann Hermanns und ein mittelmäßiger Liedschreiber war: Löhr macht ihn in seiner Ergebenheit gegenüber Hermann, der ihn einst bei einem Hauseinsturz in Erfurt buchstäblich „aus der Scheiße gezogen“ hat, zum fiesen Auftragsintriganten. Biterolf dagegen, in der Überlieferung meist als ein wenig ungeschlachter Choleriker und alter Haudegen gezeichnet, ist bei Löhr ein junger, schüchterner Sänger, für den das Ereignis die erste Bewährungsprobe darstellt. Fast noch mehr umgewöhnen muss man sich bei Heinrich von Ofterdingen, dem Sängerkriegs-Provokateur. Hatte man ihn bislang doch als geradlinigen, ehrlichen und ein wenig tragischen Helden vor Augen – ein Aspekt, den Novalis und Hoffmann gerne aufgriffen, um ihn zu einem sehnsüchtig Suchenden auf der Spur der blauen Blume zu machen! Bei Löhr trägt er ganz andere Züge: Es die schiere Lust am Widerspruch und am Abenteuer, die ihn treibt, er tritt grob, aufschneiderisch und hinterhältig auf. Auch seine Lieder sind eher derberen Zuschnitts, dafür ist er ein Liebling des gemeinen Volkes. Bei Löhr ist er übrigens auch der große Unbekannte, der das Nibelungenlied aufgeschrieben hat. Der Roman ist in eine kleine Rahmenhandlung rund um Luthers Versuchung durch den Teufel auf der Wartburg eingebunden: Der Teufel erzählt Luther die Geschichte, die ein zwei Teile untergliedert ist. Der erste Teil folgt grob dem als „Fürstenlob“ bekannten Handlungsstrang der Legende, am Ende steht Ofterdingens Verurteilung, so dass dieser bei der Landgräfin Sophia Schutz vor dem scharfen Schwert des Eisenacher Henkers Stempfel sucht, der ihm den Kopf abschlagen soll. Im zweiten Teil löst sich Löhr von der mittelalterlichen Vorgabe, die wundersamen Geschichten um den ungarischen Magier und Meistersänger Klingsor, der zu Ofterdingens Rettung bestellt wird, fehlen ganz. Statt dessen kommt der junge Biterolf zu seinem Entsetzen einem üblen Komplott auf die Spur. Es folgt eine höchst spannende Abenteuerroman-Sequenz, in der Biterolf sich in einer klirrend kalten Winternacht vor einem Wolf in Sicherheit bringen muss, und schließlich ein ausgedehntes Finale grande, das auch Freunde minutiöser Schlachten-Schilderungen zufrieden stellen wird: Im Sängersaal verteidigen sich die aufrechten Sänger gegen die Übermacht aus Gewalt, Politik und Betrug. Der originelle Schluss lässt Landgraf Hermann nur noch die Wahl, ob als Mörder oder Mäzen der Dichtkunst in die Geschichte einzugehen. Unbedingte Lese-Empfehlung! (lj) > Lesung von Robert Löhr aus dem Buch am 20.5. in der Lindenmühle Burguffeln, zusammen mit Minnesänger Holger Schäfer. > Roman bestellen für 17 Euro plus 3 Euro Versand. Novalis: Heinrich von Ofterdingen. Roman(fragment)  Eines
der Aufbruchsbücher der Romantik: Hier erscheint erstmals das Bild
der "Blauen Blume", das zum Topos der Epoche der Epoche werden soll.
Ofterdingen träumt von ihr und wird damit seine Sehnsucht nicht
mehr los. Die Mutter weiß sich nicht anders zu helfen, als dass
sie mit dem Eisenacher Handwerkersohn eine Reise unternimmt, es geht
zum Großvater nach Augsburg. Auf dem Weg dorthin bekommt
der junge Heinrich von mitreisenden Kaufleuten Märchen
erzählt, er lernt auf einer Burg protzende Kreuzfahrer und eine
unglückliche, aus dem Heiligen Land mitgebrachte Sarrazenin
kennen, er lässt sich von den Preisungen der Bergbaukunst
begeistern und er begegnet im Stollen einem Einsiedler, dem Grafen von
Hohenzollern. Dieser hat ein faszinierendes Buch in okzitanischer
Sprache mit Bildern von Sängern und Dichtern, darin erkennt
Ofterdingen sich selber wieder. In Augsburg angekommen, lädt der
Großvater zum großen Fest. Dort ist der meisterhafte
Sänger Klingsor aus Siebenbürgen zu Gast, der Ofterdingen
endgültig auf den Weg des Dichters bringt und ihm sogar noch seine
Tochter zur Frau gibt. Novalis wollte den Roman noch fortführen,
bis alle gemeinsam das Goldene Zeitalter ausrufen können, aber
vorher verstarb er an der Schwindsucht. Ofterdingens Liebste ließ
er vorher auch noch sterben. Alles in allem ein merkwürdiges Buch,
das sein Thema nicht so richtig finden will und sich mal in kitschiger
Schönfärberei einer harten Epoche, dann wieder in einer
mythischen Bilderflut verliert. Die Suhrkamp-Ausgabe ist vor allem
wegen ihrer Kommentierung lesenswert. (lj) Eines
der Aufbruchsbücher der Romantik: Hier erscheint erstmals das Bild
der "Blauen Blume", das zum Topos der Epoche der Epoche werden soll.
Ofterdingen träumt von ihr und wird damit seine Sehnsucht nicht
mehr los. Die Mutter weiß sich nicht anders zu helfen, als dass
sie mit dem Eisenacher Handwerkersohn eine Reise unternimmt, es geht
zum Großvater nach Augsburg. Auf dem Weg dorthin bekommt
der junge Heinrich von mitreisenden Kaufleuten Märchen
erzählt, er lernt auf einer Burg protzende Kreuzfahrer und eine
unglückliche, aus dem Heiligen Land mitgebrachte Sarrazenin
kennen, er lässt sich von den Preisungen der Bergbaukunst
begeistern und er begegnet im Stollen einem Einsiedler, dem Grafen von
Hohenzollern. Dieser hat ein faszinierendes Buch in okzitanischer
Sprache mit Bildern von Sängern und Dichtern, darin erkennt
Ofterdingen sich selber wieder. In Augsburg angekommen, lädt der
Großvater zum großen Fest. Dort ist der meisterhafte
Sänger Klingsor aus Siebenbürgen zu Gast, der Ofterdingen
endgültig auf den Weg des Dichters bringt und ihm sogar noch seine
Tochter zur Frau gibt. Novalis wollte den Roman noch fortführen,
bis alle gemeinsam das Goldene Zeitalter ausrufen können, aber
vorher verstarb er an der Schwindsucht. Ofterdingens Liebste ließ
er vorher auch noch sterben. Alles in allem ein merkwürdiges Buch,
das sein Thema nicht so richtig finden will und sich mal in kitschiger
Schönfärberei einer harten Epoche, dann wieder in einer
mythischen Bilderflut verliert. Die Suhrkamp-Ausgabe ist vor allem
wegen ihrer Kommentierung lesenswert. (lj) > Suhrkamp Basis-Bibliothek, EUR 7,00 Friedrich Torberg: Süßkind von Trimberg. Roman > Knaur, nur noch antiquarisch erhältlich |
MINNE-LINK-SAMMLUNG Alte Musik Salzburg |